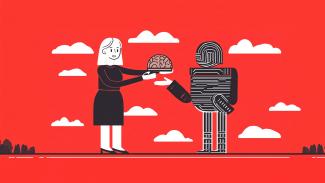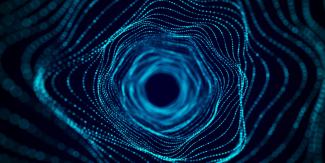Wer mit KI Geld verdienen will, sollte lieber nicht eine Ethikerin fragen, sagt Judith Simon, Professorin für – genau – Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Die Bemerkung, gefallen jüngst bei einem von Simons Vorträgen, war freilich nicht ganz ernst gemeint. Denn die Chance, mit künstlicher Intelligenz Abläufe effizienter zu gestalten und Entscheidungen zu verbessern, wird Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend verändern. Fragen digitaler Ethik unter anderem zu Privatheit, Transparenz und Teilhabe sollten da nicht fehlen.
Ökonomisches Denken und ethische Fragestellungen sind nur zwei Bereiche, die die Beraterin Sarah J. Becker in ihrem Lebenslauf und in ihrer Tätigkeit vereint. Bei Deloitte leitet sie den Bereich Ethics and Corporate Digital Responsibility. Seit vielen Jahren begleitet sie Unternehmen und Organisationen auf dem deutschen und dem nordamerikanischen Markt bei der digitalen Transformation. Ethische Fragen sind ihr Spezialgebiet, ein Thema, das sie leidenschaftlich verfolgt. Wie sehr, ist der Enddreißigerin deutlich anzumerken. Becker spricht schnell, mit Nachdruck und schöpft sichtlich aus dem Vollen ihrer Erfahrungen. Quer durch alle Branchen seien Unternehmen heute stark technologiegetrieben. Die Entwicklungen machten in schneller Folge große Sprünge. Gleichzeitig entstünden dadurch neue Fragen darüber, wo beispielsweise die Grenzen des Daten- und Technologieeinsatzes liegen, sagt sie: „Nehmen wir zum Beispiel Tracking-Apps oder die mit dem Smartphone vernetzten Fitnessarmbänder, die Körperdaten sammeln. Seit sie sich so stark verbreiten, ist klar, dass der vermessene Mensch zur größten denkbaren Datenplattform geworden ist. Wie weit dürfen wir dabei gehen?,“ fragt sie beim Gespräch im Düsseldorfer Heinrich Campus von Deloitte.
Dass der Deloitte-Partnerin beim Thema digitale Ethik als erstes der menschliche Körper in den Sinn kommt, verwundert nicht. Sie hat zwar Wirtschaftswissenschaften an der Universität Witten-Herdecke studiert, dann aber ein Medizinstudium angehängt und schließlich organisationssoziologisch promoviert. Natürlich habe sie sich von dem Potenzial der Digitalisierung im Gesundheitswesen begeistern lassen: „Diagnose, Behandlung, Therapie und Forschung lassen sich dank Daten und zugehörigen Technologien entscheidend verbessern.“ Damit rücken die in der Medizin ohnehin alltäglichen ethischen Fragestellungen noch stärker in den Vordergrund. Und nicht nur dort: Auch in anderen Branchen basieren die Geschäftsmodelle zunehmend auf Daten, nur gibt es dort noch keine eingespielten Prozesse im Umgang mit digitaler Ethik. Darum gründete Becker bereits 2017 mit dem Chirurgen Dr. André T. Nemat das Institute for Digital Transformation in Healthcare (idigiT) als Spin-off der Universität Witten-Herdecke, um Unternehmen und Organisationen vom internationalen Konzern bis zur Non-Profit-Organisation in Fragen digitaler Ethik und Transformation zu beraten.
Das Bewusstsein für digitale Ethik ist heute etabliert
Es war ein Sprung ins noch recht kalte Wasser. Zwar hatte Becker schon Stationen in der Industrie und der Beratung absolviert und mit einer Recruiting-Plattform für Krankenhäuser bereits Gründungserfahrung gesammelt. „Aber wir waren unserer Zeit etwas voraus. Das habe ich damals auch an den Reaktionen meines direkten Umfelds gemerkt“, lacht sie. Auch bei CEOs und anderen Führungskräften sorgten Fragen der digitalen Ethik damals meist noch für fragende Blicke. Doch der Schritt sollte sich als der Richtige herausstellen. Neben ihrer Tätigkeit als Beraterin, entwickelt Becker das Thema auch in Gremien weiter wie der AG Digitale Ethik bei der Initiative D21, Deutschlands größtem gemeinnützigen Netzwerk für die Digitale Gesellschaft. Zufrieden stellt sie fest, dass sich die Wahrnehmung komplett gedreht habe: „Heute müssen wir kaum jemandem noch erklären, warum wir eine digitale Ethik brauchen.“
Das Problem sei inzwischen ein anderes: Alle wollten sofort zum „Wie“, zur Umsetzung übergehen, ohne sich zu fragen, was das eigentlich sei, die digitale Ethik. Für Becker geht es darum, die Auswirkungen digitaler Innovationen auf den Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt zu untersuchen und zu bewerten. Dazu gehören Fragen der Privatheit, der Transparenz, der digitalen Ungleichheit und andere, die durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz immer drängender werden. Im Mittelpunkt digitaler Ethik steht die Reflexion über die Verantwortung von Unternehmen bei der Entwicklung und dem Einsatz digitaler Technologien. Doch Becker will damit nicht etwa Entwicklungen verhindern, im Gegenteil: „Wir sind keine Bedenkenträger, sondern wollen mit der Arbeit an der digitalen Ethik den sicheren Rahmen schaffen, in dem Innovationen erst möglich sind“.
Und damit ist das „Wie“ schon in wenigen Worten erläutert. Digitale Prozesse, Datensammlung, Analyse und der Einsatz von KI machen zwar großartige neue Produkte möglich. Die Erfahrung zeige aber, so Sarah J. Becker, dass die besten und schönsten Ideen auch ihre Schattenseiten haben können: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln unbestimmte Störgefühle, eine Angst vor nicht intendierten Effekten, und Unternehmen tun gut daran, solche Bedenken frühzeitig zu adressieren und zu lösen. Dafür brauche es klare Leitlinien, die definieren, was geschützt und was verhindert werden soll. Dabei verweist sie auf die Grundprinzipien der Bioethik – Selbstbestimmung, Schadensvermeidung, Patientenwohl und Gerechtigkeit: Menschen sollen selbst entscheiden können, mögliche Risiken minimiert werden. Alles Handeln soll ihrem Wohl dienen und Ressourcen sollen gerecht verteilt werden. „Das lässt sich zwar nicht direkt auf andere Branchen übertragen, bietet aber einen Ansatz für Bewertungs- und Entscheidungsprozesse, der bisher fehlte.“
Standardisierte Fragen helfen Unternehmen, richtig zu handeln
Mit der griffigen Formel „Was können wir, was wollen wir, was dürfen wir?“ bringt Sarah J. Becker schließlich das Spannungsfeld einer digitalen Ethik auf den Punkt. Als Medizinerin und Wissenschaftlerin mit einem soziologischen Blick auf ihre Profession sieht sie einen entscheidenden Unterschied zur Wirtschaft: In der Medizin gebe es die Notaufnahme, in der harte Entscheidungen oft sehr schnell getroffen würden, und es gebe Gremien, in denen in Ruhe über die Behandlung von Krebsfällen entschieden werde. „In beiden Situationen verlassen sich Ärztinnen und Ärzten auf ihre intuitiv gelernte Berufsethik. In Unternehmen steckt das Thema Ethik vielfach noch in den Kinderschuhen, deshalb ist dort eine standardisierte, prozesshafte Vorbereitung auf solche Fragen nötig.“ Die Integration einer digitalen Ethik in Unternehmen hänge darüber hinaus von den Geschäftsprozessen, der Unternehmenskultur und der Kommunikation im Unternehmen ab. „Das macht die Sache so herausfordernd und spannend. Die allgemeinen ethischen Grundprinzipien mögen sich ähneln. Aber die Lösung ist immer individuell“, erklärt sie.
Zunächst müsse geklärt werden, worum es geht: „Wir zeigen den Unternehmen, wie sie die richtigen Fragen stellen und wie sie diese strukturiert beantworten. Wir helfen ihnen, Prozesse zu etablieren, um die ethischen Implikationen zu bearbeiten und die Haltung des Unternehmens dazu zu klären, jetzt und in Zukunft.“ Und wer sollte dafür sorgen, dass die digitale Ethik in der Organisation verankert wird? Von einem zentralen Chief Ethics Officer, wie es ihn im angelsächsischen Raum gibt, hält Becker wenig. „Ein CEO kann die Verantwortung für digitale Ethik nicht delegieren, sondern trägt dafür Sorge, dass entsprechende Strukturen geschaffen werden.“
»Ein CEO kann die Verantwortung für digitale Ethik nicht delegieren, sondern trägt dafür Sorge, dass entsprechende Strukturen geschaffen werden.«
Dr. Sarah J. Becker Wirtschaftswissenschaftlerin, Medizinerin und Soziologin
Bedenkenträgerinnen sind dabei weder Judith Simon noch Sarah Becker. „Ich bin eher der Typ ‚Leben und leben lassen‘“, sagt Becker. Aber sie vereint zwei Erfahrungen, die sich bestens ergänzen. Als Medizinerin ist sie an ethische Fragestellungen gewöhnt, denn bei der Behandlung geht es immer um „Können, Dürfen, Wollen“. Geprägt vom analytischen Blick der Soziologie und ihrem Verständnis für soziale Strukturen, Interaktionen und Dynamiken schaut sie mit geübtem Blick hinter die Kulissen, und will wissen, warum die Dinge so sind wie sie sind und wie sie funktionieren. „Gute Ideen faszinieren mich ebenso wie das, was bei ihrer Entwicklung übersehen wird. Deshalb müssen wir Implikationen früh klären. So können wir ein gutes Umfeld für Innovationen und die vor uns liegende technologische Transformation schaffen. Daran muss sich unsere Arbeit messen lassen.“
Die fünf wichtigsten Leitlinien für einen gelungenen Umgang mit digitaler Ethik in Unternehmen
- Innovative digitale, datenbasierte Produkte können nicht intendierte Effekte haben
- Störgefühle und Bedenken im Unternehmen sollten frühzeitig adressiert werden
- Für die integrierte digitale Ethik müssen Unternehmen strukturierte Prozesse etablieren
- Klare ethische Leitlinien definieren, was geschützt und was verhindert werden soll
- Digitale Ethik im Unternehmen schafft einen sicheren Rahmen für Innovationen

Dr. Sarah J. Becker
Dr. Sarah J. Becker ist Partnerin bei Deloitte und leitet den Bereich Digital Ethics und Corporate Digital Responsibility (CDR) auch auf europäischer Ebene. Seit über 15 Jahren begleitet sie DAX-notierte Unternehmen, Familienunternehmen, Non-Profit-Organisationen und öffentliche Institutionen im deutschen sowie US-amerikanischen Markt bei deren digitaler Transformation.