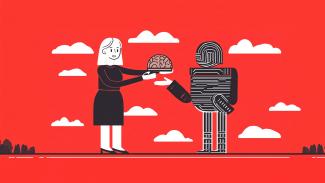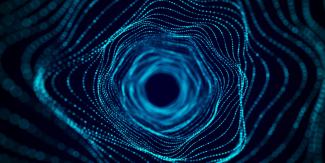Herr Hochreiter, Sie haben Ende der 90er Jahre ein Langzeitgedächtnis für maschinelles Lernen mitentwickelt, ohne das der Siegeszug der Sprach-KIs heute nicht möglich wäre. Wie groß ist unsere Verantwortung, das Vertrauen in neue Technologien zu fördern?
Sehr groß. Vertrauen ist entscheidend dafür, ob eine Technologie angenommen wird oder nicht. Wir müssen die Menschen aufklären, dass es sich weder um Magie noch um eine Bedrohung handelt, sondern um ein Hilfsmittel. Wer das versteht, hat weniger Angst. Was dabei erlaubt ist und was nicht, muss deshalb immer gesellschaftlich ausgehandelt und entschieden werden – vor Ort und demokratisch.
Wer trägt konkret die Verantwortung für Nutzen und Risiko der KI?
Zum einen sind es die Entwickler und Unternehmen, die KI-Systeme auf den Markt bringen. Sie tragen die Verantwortung, wie die Hersteller anderer technischer Produkte auch. Andererseits sind die Anwender verantwortlich, da sie über den sinnvollen oder missbräuchlichen Einsatz entscheiden. Gesellschaften müssen zudem Regeln festlegen, wie weit der Einsatz gehen darf. Die Verantwortung liegt also immer beim Menschen, nicht bei der Maschine.
Wie viel Verständnis haben Sie für die Sorgen vieler Menschen, durch neue Technologien wie KI ersetzt zu werden?
Ich halte es für einen Irrtum, dass künstliche Intelligenz Arbeitsplätze vernichtet, aber natürlich verändert sie Arbeitsprozesse. Wie der Computer einst die Büroarbeit revolutionierte, wird KI auch Abläufe effizienter machen: Eine Mail an einen Kunden kann man mit ChatGPT in wenigen Minuten verfassen, Führungskräfte können sich Berichte zusammenfassen lassen, um schneller Entscheidungen zu treffen. Vom Produktionsmitarbeiter bis zum CEO – alle werden KI künftig als zusätzliches Werkzeug nutzen. Die Arbeit bleibt, sie wird nur anders aussehen.
Die Verantwortung liegt also immer beim Menschen, nicht bei der Maschine.
Prof. Sepp Hochreiter Leiter des Instituts für Maschine Learning an der Johannes Kepler Universität Linz
Angesichts der hohen Investitionen in KI in den USA und China stellt sich die Frage: Was braucht es, damit Europa bei der KI mithalten und unabhängig bleiben kann?
Europa muss mehr investieren – in Forschung, in Start-ups und in die Infrastruktur. Zwar haben wir große Rechenzentren, doch sie sind fragmentiert und für die riesigen Modelle, die für KI benötigt werden, nicht ausreichend. Wir brauchen so genannte GPU-Cluster, also parallel geschaltete Prozessoren. Erst mit ihrer enormen Rechenleistung sind wir in der Lage, eigene Moonshot-Projekte umzusetzen, also besonders kühne, aber risikoreiche Vorhaben, die zu großen technologischen Durchbrüchen führen könnten. Außerdem müssen wir unsere Denkweise ändern: In den USA gründen Forscher aus einer Idee heraus sofort ein Unternehmen, während viele Europäer in dieser Rolle eine Professur anstreben. Wir brauchen mehr Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie. Forscher sollten sich selbstverständlich zwischen Universität und Unternehmen bewegen können.
Warum konnte Europa von seinem Vorsprung nicht stärker profitieren?
Ideen hatten wir genug. Aber wir haben Schwierigkeiten, Innovationen in Unternehmen und auf Märkten zu etablieren. Viele Entscheider haben Berührungsängste mit KI und halten lieber am Status quo fest. Oft dauert es, bis eine neue Generation nachrückt, die keine Scheu mehr hat. Zudem fehlt in Europa der enge Austausch zwischen Forschung und Industrie, wie er in den USA selbstverständlich ist.
Hat Europa eine Chance, in Sachen Technologie noch aufzuholen?
Ja, in der nächsten Phase der KI-Entwicklung. Nach der Grundlagenforschung und der Skalierungsphase beginnt nun die Industrialisierung: Es werden kleinere, spezialisierte Modelle entwickelt, die direkt in Maschinen oder Autos eingesetzt werden können. Genau hier kann Europa mit energieeffizienten und schnellen Modellen punkten. Das ist besonders wichtig für Anwendungen in Autos, Drohnen oder Produktionsanlagen, wo große Rechenzentren nicht verfügbar sind. Wir müssen nicht die Größten haben, aber wir können die Effizientesten bauen.
Forscher sollten sich selbstverständlich zwischen Universität und Unternehmen bewegen können.
Professor Sepp Hochreiter Leiter des Instituts für Maschine Learning an der Johannes Kepler Universität Linz
Warum ist es überhaupt so wichtig, bei diesem Rennen vorne mit dabei zu sein?
Weil es um Produktivität und Unabhängigkeit geht. KI steigert die Effizienz: Dieselbe Arbeitszeit bringt eine höhere Leistung. In Europa, wo Arbeit teuer ist, ist das überlebenswichtig. Wenn wir uns jedoch nur auf amerikanische oder chinesische Systeme verlassen, geben wir die Wertschöpfung aus der Hand. Außerdem spiegeln diese Systeme ihre eigenen Werte wider. ChatGPT basiert beispielsweise vor allem auf US-Daten und transportiert unbewusst amerikanische Moralvorstellungen. Wenn wir unsere Kinder nur mit solchen Tools arbeiten lassen, geben wir auch kulturelle Souveränität ab. Aus ökonomischen und gesellschaftlichen Gründen brauchen wir deshalb eigene Technologien.
Was sagen Sie jungen Menschen, die heute in die KI-Forschung oder -Entwicklung einsteigen? Machen Sie Mut? Warnen Sie? Oder beides?
Ich sage meinen Studierenden im Spaß: „Passt auf, ihr könnt mit KI sehr leicht reich werden – und reich zu sein, ist gefährlich.“ Aber im Ernst: Die Chancen sind riesig, die Risiken auch. KI kann Menschen manipulieren, Fake News verstärken und Filterblasen zementieren. Das müssen junge Leute wissen. Meine Botschaft ist deshalb: Die Technik selbst ist neutral. Gut oder böse hängt vom Einsatz ab. Es ist eure Verantwortung, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was KI kann und was nicht. So können Politik und Gesellschaft informierte Entscheidungen treffen. Moralische Verantwortung bedeutet nicht, eine Technik künstlich zu verlangsamen, sondern transparent zu machen, was sie leistet und was nicht.

Professor Dr. Sepp Hochreiter
leitet das Institut für Maschine Learning an der Johannes Kepler Universität Linz und ist Mitgründer des Start-ups NXAI. Er hat in den 1990er Jahren ein Langzeitgedächtnis für maschinelles Lernen entwickelt (Long Short-Term Memory), das er zusammen mit seinem Doktorvater Jürgen Schmidhuber publiziert hat. Damit hat er die Grundlagen für heutige KI-Anwendungen und neue Architekturen wie xLSTM und „TiRex“ gelegt.