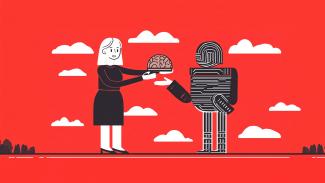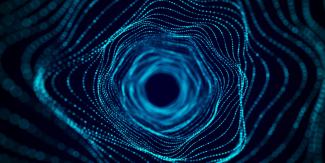Herr Schulte, wie der Einsatz von Software die Funktionalitäten eines Fahrzeugs verändern kann, ist derzeit eines der beherrschenden Themen in der Automobilindustrie. Was ist daran so spannend?
Leif-Erik Schulte: In klassischen Fahrzeugen gibt es eine dezentral arbeitende Software, deren Aufgabe es ist, die Hardware zu unterstützen. Die Bedeutung von Software im Auto nimmt aber immer weiter zu. Die Transformation zum Softwaredefinierten Fahrzeug ist längst im Gange. Dabei wird die Software-Architektur zum zentralen Bestandteil und bestimmt die Funktionalität des Fahrzeugs. Ein SDV wird quasi um die Software herum gebaut. Damit einher geht auch, dass das Fahrzeug eine Verbindung nach außen haben muss, denn von dort bezieht es Updates - und auch Upgrades.
Herr Pritsch, wie wird diese neue Art des Fahrzeugbaus unsere Mobilität in Zukunft konkret verändern?
Elmar Pritsch: Erstmals in der Geschichte des Automobils können Eigenschaften und Funktionen nach der Auslieferung grundlegend verändert werden. Früher musste dafür die Hardware ausgetauscht werden. Heute reicht ein drahtloses Software-Update über die Luftschnittstelle, ein sogenanntes Over-the-Air-Update - und das über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs hinweg. Damit werden Fahrzeuge auch individueller, vergleichbar mit einem Smartphone, das im Auslieferungszustand noch nicht auf den Nutzer zugeschnitten ist und erst später durch zusätzliche Apps angepasst wird.
Schulte: Man könnte ein überarbeitetes Entertainmentsystem installieren oder die Reichweite erhöhen. Selbst die Farbe ließe sich ändern, spezielle Lacke machen es möglich. Das per Software-Update selbst zu machen, ist auch viel effizienter und kostengünstiger als der Besuch in der Werkstatt. Für die Automobilindustrie ist das sehr attraktiv.
Welche Daten müssen die Nutzer für die neuen Funktionen preisgeben und ist für deren Verarbeitung der Einsatz von KI notwendig?
Schulte: Grundsätzlich geht es um alle Daten, die ein SDV sammelt und weitergeben kann, je nachdem, welche Funktionen im Fahrzeug aktiviert sind. Diese wiederum hängen davon ab, welche Daten die Nutzerinnen und Nutzer von sich preisgeben wollen und welche nicht. So brauche ich mir zum Beispiel keine Einkaufs-App aufs Auto spielen, wenn ich nicht bereit bin, meine Kreditkarten- oder Kontodaten zu hinterlegen. Die Einstellungen sind hier kulturell sehr unterschiedlich: In Europa ist Datenschutz ein großes Thema, in China und den USA sieht man das lockerer. Gerade in den USA fühlen sich die Nutzerinnen und Nutzer als Teil des Entwicklungsteams und tragen gerne mit ihren Daten zur Entwicklung neuer Funktionen bei.
Pritsch: Viele Fahrzeuge haben heute schon zahlreiche Sensoren: Außen für die Wahrnehmung der Umgebung, um zum Beispiel im Notfall einen Bremsvorgang einzuleiten, aber auch innen. Wenn es um Fahrzeugsicherheit geht, sind diese Daten sehr wichtig. KI kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn mit großen Datenmengen autonome Fahrfunktionen trainiert werden. So bereiten die Hersteller ihre Fahrzeuge durch Simulationen auf den Ernstfall vor.
Herr Schulte, in welcher Verantwortung sieht sich der TÜV mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung der Fahrzeuge?
Schulte: Für den TÜV war die Fahrzeugsicherheit schon immer das bestimmende Thema, und das gilt nicht nur für die Mechanik, sondern auch für die Software. Wir verstehen uns als Partner der Hersteller, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die langfristige Sicherheit der Fahrzeuge zu gewährleisten.
Einerseits erhöhen Assistenzsysteme die Sicherheit, andererseits ist Technik nie unfehlbar. Wie sehr können wir ihr vertrauen?
Pritsch: Das ist ein evolutionärer Prozess. Wir haben heute viele Assistenzsysteme, die wir gerne nutzen, wie das Antiblockiersystem, den Abstandswarner oder die Müdigkeitserkennung des Fahrers. Mit den neuen Systemen, die auf Konnektivität setzen, kommen neue Fragen hinzu, auch zur Cybersicherheit. Verschlüsselung, redundante Systeme und regelmäßige Updates sind unerlässlich, um solche Risiken zu minimieren.
Schulte: Der Schutz, den die Fahrzeuge wie unsere PCs oder Smartphones brauchen, um nicht gehackt zu werden, ist auf europäischer Ebene bereits geregelt. So soll sichergestellt werden, dass nur Software im Fahrzeug verbaut ist, die dort auch hingehört, also keine Viren, Trojaner oder Ähnliches, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Das heißt aber auch: Updates gehören künftig zur Fahrzeugwartung wie heute die Kontrolle des Reifendrucks.
TÜV NORD und Deloitte haben eine Plattform entwickelt, über die die Homologation, also die Zulassung neuer Fahrzeugsoftware, digital abgewickelt werden kann. Wie funktioniert das genau?
Pritsch: Die Plattform ermöglicht es den Entwicklern, die Anforderungen verschiedener Märkte wie Europa oder USA zu verstehen und umzusetzen. Die Kernidee ist, die regulatorischen Anforderungen direkt in den Entwicklungsprozess zu integrieren – um die Typgenehmigung, also Bestätigung der Behörde, dass das serienmäßig hergestellte Produkt gesetzlichen Standards genügt, zu erleichtern. Dieser transparente Prozess zeigt auch Dritten, welche regulatorischen Anforderungen eingeflossen sind, und welche Tests und Simulationen durchgeführt wurden. Derzeit sind diese Prozesse oft aufwändig und manuell, weshalb Automatisierung und Digitalisierung entscheidende Fortschritte bringen werden.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern?
Schulte: Eine Datenbank mit Szenarien für automatisierte Fahrfunktionen könnte kontinuierlich um neue Szenarien aus dem laufenden Fahrzeugbetrieb erweitert werden. Künftig könnten Fahrzeuge mit Hilfe von KI solche Szenarien selbst erkennen und in die Typgenehmigung einfließen lassen. So entsteht ein Kreislauf, der kontinuierlich Daten sammelt und integriert. Dieses Modell könnte Regulierungsprozesse revolutionieren, indem sie schneller und dynamischer auf Veränderungen reagieren.
Pritsch: Wenn wir das fortführen und an ein Ökosystem denken, in das nicht nur Hersteller, sondern auch Dritte ihre Software einbringen können, wird es noch spannender. Dann könnte ein offenes Ökosystem entstehen, wie wir es vom Smartphone kennen, auf dem wir ja auch Apps unterschiedlicher Anbieter nutzen. Und auch dafür wäre dann eine entsprechende Prüfung notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Digitalisierte Genehmigungsprozesse sind nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Herausforderung. Sind wir darauf vorbereitet?
Pritsch: Diese Transformation hat drei Aspekte. Erstens: Technisch ist vieles bereits machbar. Zweitens müssen wir effizienter werden, damit Autos bezahlbar bleiben. Und drittens brauchen wir einen kulturellen Wandel – vor allem bei Entscheidern und Entwicklern. Am Anfang werden nicht alle mitziehen, aber wir können mit guten Beispielen zeigen, dass sich dieser Weg lohnt.
Schulte: Wichtig ist, dass alle Beteiligten – von den Entscheiderinnen und Entscheidern bei Herstellern und Behörden bis hin zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern – Vertrauen in die Technik haben. Dieses Vertrauen müssen wir schaffen, und das geht am besten, wenn wir zeigen können: Es funktioniert, es ist sicher und es macht Spaß. Ein Marktplatz für Auto-Apps wird nur funktionieren, wenn die Nutzerinnen und Nutzer Lust haben, ihr Fahrzeug zu individualisieren, oder wenn sie die Vorteile sehen – zum Beispiel durch Updates, die etwa die Sicherheit erhöhen, oder auch durch zusätzliche Komfort-Features.
Wie schnell werden SDVs auf dem Fahrzeugmarkt an Bedeutung gewinnen?
Pritsch: Ich rechne damit, dass der Anteil bei Neufahrzeugen zum Ende des Jahrzehnts 90 Prozent betragen wird. Einsatzfähig ist die Technik schon heute, es fehlt nur noch die Skalierung. Neue Produzenten, die ihre Fahrzeuge quasi auf der grünen Wiese entwickeln konnten, setzen stark auf den SDV-Ansatz, haben aber nicht die großen Volumina der traditionellen Hersteller erreicht. Letztere wiederum sind gerade noch mit der Umstellung auf SDV beschäftigt, aber schon im nächsten Jahr werden wir bei den meisten etablierten Herstellern weitere digitale Zusatzfunktionen per Over-the-Air-Update nachladen können.
Vorreiter oder Nachzügler: Welche Rolle spielt Europa dabei?
Schulte: Europa kann mit seinen hohen Anforderungen an Sicherheit und Transparenz einen globalen Standard setzen, insbesondere für autonome Fahrfunktionen. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind zwar weltweit unterschiedlich, aber die Grundlagen wie Compliance und Sicherheitsanforderungen sind universell. Europa hat die Chance, seine Prinzipien zu exportieren und eine vergleichbare Bedeutung wie die frühere deutsche Industrienorm zu erlangen.
Pritsch: Europa muss stärker auf Kooperationen setzen, um im internationalen Wettbewerb mit den USA und China bestehen zu können. Partnerschaften zwischen Automobilherstellern und Zulieferern könnten die Innovationskraft stärken und die hohen Investitionen effizienter machen. China und die USA mögen Vorreiter bei Skalierung und Innovation sein. Aber Europa hat noch ein enormes technologisches Potenzial. Es ist wichtig, jetzt zu handeln, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten, denn die Gefahr, von den chinesischen Herstellern und ihren fortschrittlichen SDV überholt zu werden, ist real.

Leif-Erik Schulte
ist ein erfahrener Experte in der Automobil- und Mobilitätstechnologie. Seit 2018 leitet er das Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität (IFM) bei TÜV NORD Mobilität. Das Institut gilt als einer der führenden Technischen Dienste im Bereich Automobil und Mobilität in Europa. Zu Schultes Aufgaben gehören die internationale Geschäftsentwicklung sowie die Arbeit an Zukunftsthemen wie vernetztem Fahren und Elektromobilität.
Dr. Elmar Pritsch
ist Partner bei Deloitte Consulting und berät weltweit führende Unternehmen der Automobilbranche im Kontext Software Defined Vehicle. Dabei konzentriert er sich auf die Strategieentwicklung und -umsetzung im Zusammenhang mit der digitalen Transformation sowie neu entstehender Ökosysteme im Rahmen von Allianzen und Entwicklungspartnerschaften.