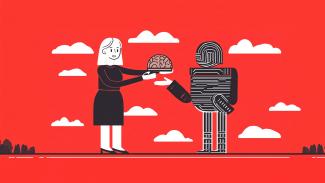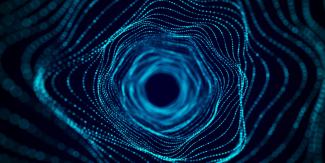Herr Professor Weber, die Gesellschaft in Deutschland altert schneller als in anderen Ländern. Dadurch droht der wirtschaftliche Output zu sinken. Können Digitalisierung und KI dies ausgleichen?
Prof. Dr. Enzo Weber › In den vergangenen 20 Jahren waren wir es gewohnt, Beschäftigung immer weiter zu steigern, weil es auch immer mehr Arbeitskräfte gab. Damit ist es jetzt vorbei. Allein durch Alterung verlieren wir in den nächsten 15 Jahren rund sieben Millionen Arbeitskräfte. Gerade KI ist aber eine Technologie, die quer durch alle Branchen wirken kann. Deshalb hat sie enormes Potential für Produktivitätsgewinne und kann dazu beitragen, die Wertschöpfung zu steigern. Schließlich ist Produktivität der einzige Weg zu mehr Wohlstand. Kein Land wird wohlhabend, indem die Menschen einfach länger arbeiten, sondern durch Technologie und Qualifizierung.
Sie erwarten durch Künstliche Intelligenz keinen Einbruch der Beschäftigung, sondern einen Umbruch. Wie wird der aussehen?
Weber › Definitiv wird KI Tätigkeiten übernehmen, die heute Menschen ausüben. Sonst gäbe es aus betriebswirtschaftlicher Sicht ja gar keinen Anreiz, solche Technologien einzusetzen. Neue Technologien schaffen jedoch auch neue Bedarfe – für Entwicklung, Einsatz und Pflege sowie für neue Geschäftsmodelle. Der entscheidende Punkt ist, dass wir Technologie so einsetzen, dass sie uns produktiver macht. Denn wenn wir die Produktivität erhöhen, entsteht dadurch Einkommen. Und Einkommen schafft Nachfrage, die wiederum neue Jobs schafft – auch in Bereichen, die nichts mit KI zu tun haben. Wenn wir die Produktivität steigern, wird daraus nicht weniger Arbeit, sondern andere Arbeit. Die Vorstellung, dass technischer Fortschritt automatisch Arbeitsplätze vernichtet, ist ein Missverständnis. Jede Welle des technologischen Wandels hat Arbeitsstrukturen verändert, und das wird auch diesmal so sein.
Die Frage ist jedoch, ob davon alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen profitieren.
Weber › Wir kennen aus der Vergangenheit natürlich Beispiele, bei denen der technologische Wandel die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt negativ beeinflusst hat. Denken wir etwa an die 70er-, 80er- und 90er-Jahre sowie die 2000er. Die Arbeitslosigkeit ist ständig gestiegen. Die Ursache lag dabei nicht nur im technologischen, sondern auch im strukturellen Wandel, durch den Menschen abgehängt wurden. Frühere Strukturprobleme müssen für die Arbeitsmarktpolitik eine Warnung sein. Aber erstaunlich ist doch, wie viel wir darüber nachdenken, was KI alles können wird. Im Gegensatz dazu scheinen wir uns Menschen nur wenig Entwicklungspotential zuzutrauen. Dabei ist das doch die größte Chance: uns selbst und unsere Arbeit weiterzuentwickeln.
Wie sollte unser Bildungssystem auf diese Transformation reagieren? Welche Kompetenzen werden künftig besonders gefragt sein?
Weber › Meine Empfehlung ist, die Menschen noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen und in Lernkonzepte zu investieren, die es ermöglichen, mit Veränderung offen umzugehen. Gefragt sind IT-Fähigkeiten, aber vor allem auch Kompetenzen wie inhaltliche Flexibilität, Selbstorganisation, Kommunikationsfähigkeit, Abstraktionsvermögen und Lernbereitschaft. Das sind Fähigkeiten, die uns dabei helfen, Technologien sinnvoll einzusetzen. Dazu gehört das Bewusstsein, dass ein Abschluss nicht mehr als Endpunkt verstanden wird. Unser Bildungssystem muss darauf vorbereiten, dass Lernen nie abgeschlossen ist, sondern immer neue Möglichkeiten bietet.
Welche Strategien sollten Unternehmen und Politik verfolgen, um effektive Weiterbildungsmaßnahmen zu implementieren?
Weber › Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden befähigen, KI konkret in ihrem Arbeitsalltag zu nutzen. Niederschwellige, praxisnahe Angebote sind entscheidend, nicht theoretische Standardkurse. Lernen muss an die Realität anknüpfen.
Viele KI-Anwendungen betreffen hochqualifizierte Tätigkeiten, etwa in Forschung, Medizin oder Journalismus. Wie verändert das das Selbstverständnis dieser Berufe?
Weber › Das Selbstverständnis wird sich ändern, weil sich die Tätigkeiten ändern. Gerade für Hochqualifizierte ist das eine Chance, denn diese Menschen haben in der Regel die besten Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln. Wenn wir uns fragen: Warum habe ich meinen Beruf ursprünglich ergriffen? Und was tue ich tatsächlich? Dann werden viele erkennen, dass sie mit neuer Technologie wieder mehr von dem tun könnten, was sie eigentlich antreibt.
Gibt es dennoch menschliche Fähigkeiten, die KI auch in Zukunft nicht beherrschen wird?
Weber › Echte Kreativität kann KI bisher nicht leisten. Ebenso wenig kann sie in Bereichen tätig werden, in denen explizit menschlicher Kontakt gewünscht ist, beispielsweise in der Erziehung oder in der Pflege. Auch viele vermeintlich einfache Helfertätigkeiten sind für KI zu komplex. Aber das muss natürlich nicht so bleiben. Und: Sich absichtlich einen „KI-sicheren“ Job zu suchen, in dem es niemals Fortschritt geben kann, wäre eine traurige Perspektive. Es sollte doch vielmehr darum gehen, wie wir uns selbst weiterentwickeln.
Wie schneidet Deutschland im internationalen Vergleich bei der Integration von KI in den Arbeitsmarkt ab? Was können wir von anderen Ländern lernen?
Weber › Es gibt klare Fortschritte bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI in der Wirtschaft, aber wenn man sich die Statistiken zur Digitalisierung insgesamt anschaut, dann liegt Deutschland im internationalen Vergleich doch eher im Mittelfeld. Finnland oder die Niederlande, um nur zwei Beispiele aus Europa zu nennen, sind uns in puncto digitale Kompetenzen deutlich voraus. Natürlich können auch junge Menschen in Deutschland digitale Geräte intuitiv bedienen, aber das allein reicht nicht aus. Man muss lernen, wie man Technologie konzeptionell einsetzt, so dass daraus Wertschöpfung entsteht.
Wie wird KI die Arbeitswelt in Deutschland verändern?
Weber › In zehn Jahren können sich Menschen auf die Tätigkeiten konzentrieren, für die sie ihren Beruf einmal gewählt haben. Wir führen dann keine Debatten mehr darüber, ob wir länger oder kürzer arbeiten sollten. Und Löhne und Produktivität steigen endlich wieder. Das ist ein positives, aber erreichbares Szenario – das sicher nicht von allein kommt. Jeder, der arbeitet, sollte einen Teil seiner Zeit darauf verwenden, sich und seinen Job weiterzuentwickeln. Dann schaffen wir das.

Enzo Weber
Prof. Dr. Enzo Weber ist Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Regensburg. Zu den Schwerpunkten seiner Forschung gehören gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarktentwicklung und Konjunktur, technologischer Wandel sowie wirtschaftliche Transformation.