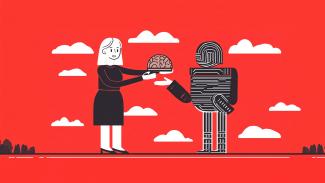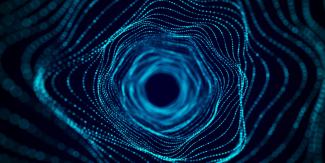Gesundheits-Apps sind mehr als nur nützliche Tools. Sie ändern die Art und Weise, wie Patientinnen und Patienten agieren können und bieten gleichzeitig medizinischem Personal neue Instrumente zur Verbesserung der Patientenversorgung und zur Verschlankung ihrer Prozesse. Die Bandbreite ist dabei groß und reicht von der Überwachung chronischer Erkrankungen über die Förderung von Prävention bis hin zur Unterstützung bei der Diagnose und Behandlung. Ein Problem für viele Patientinnen und Patienten ist auch die oft aufwendige Suche nach dem richtigen Facharzt und die lange Wartezeit für einen Termin. Eine Hautarztpraxis in Solingen hat dafür eine Lösung gefunden und 2020 die digitale Praxis Dermanostic gestartet. Per App können Menschen Fotos von ihren Hautauffälligkeiten einsenden, meist erhalten sie binnen weniger Stunden eine Diagnose von ausgebildeten Hautfachärztinnen und -ärzten – inklusive Therapieempfehlung und Arztbrief. 200 bis 300 Menschen am Tag nehmen dieses Angebot wahr, in einigen Fällen übernimmt sogar die Krankenkasse die Leistung, die bei 25 Euro anfängt und – der Digitalisierung sei Dank – weltweit verfügbar ist.
„Wir haben bei 200.000 Behandlungen über 600 differenzierte Diagnosen über die App gestellt, darunter auch seltene“, sagt Alice Martin, Ärztin und eine der Gründerinnen von Dermanostic. Häufig gehe es um typische Krankheiten wie Akne, Neurodermitis, Rosazea, Muttermale, Ekzeme, aber auch Haarausfall und Geschlechtskrankheiten. Weitere Vorteile für Patienten seien neben einer schnellen Terminfindung die transparente Information und Dokumentation. Und auch für Ärztinnen und Ärzte sei die Arbeit in einer digitalen Praxis angenehm: „Die Arbeitszeiten sind flexibel, es entfällt viel Bürokratie und der Zeitdruck einer laufenden Praxis fällt weg“, sagt Martin. Sie haben dadurch die Zeit, auch mal einen Befund nachzuschlagen und sich untereinander zu beraten.
Abrechnung von digitalen Services ist herausfordernd
Die komplexe Gesetzgebung und Regulatorik in Deutschland bleibt für Martin und ihr Team aber auch nach vier Jahren die größte Herausforderung. Da das digitale Angebot im Abrechnungskatalog nicht bedacht ist, können die Krankenkassen es nicht einfach abrechnen. Dermanostic hat daher mit einigen Kassen direkt Verträge geschlossen. Auch andere digitale Angebote scheitern noch an den komplizierten oder nicht vorhandenen Regeln in Deutschland – und das, obwohl die Politik seit Jahren die Entwicklung von elektronischen Gesundheitsanwendungen (DiGA) unterstützt, oft sogar mit finanziellen Zuwendungen. Für Ärzte und Patienten ist es nicht leicht, einen Überblick über die Vielzahl der Anwendungen zu bekommen.
»Der KV-App-Radar umfasst mehr als 3.700 Gesundheits-Apps und gibt Auskunft darüber, wie stark diese verbreitet und wie gut sie bewertet sind.«
Alice Martin Ärztin und eine der Gründerinnen von Dermanostic
„Als Arzt muss ich wissen, was welche DiGA macht – ob sie etwas nützt, ob sie schaden kann –, damit ich sie entsprechend im Behandlungsplan einsetzen kann. Es gibt zwar das DiGA-Register oder den App-Radar der Kassenärztlichen Vereinigung, aber diese Informationsportale sind noch ausbaufähig“, sagt Erik Bodendieck, Co-Vorsitzender des Ausschusses „Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung“ der Bundesärztekammer. Der KV-App-Radar umfasst mehr als 3.700 Gesundheits-Apps und gibt Auskunft darüber, wie stark diese verbreitet und wie gut sie bewertet sind.
Die allermeisten dieser Apps sind ohnehin Privatleistungen. Im offiziellen DiGA-Register des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sind lediglich 60 Apps aufgeführt, die meisten im Bereich Psyche, aber auch Kategorien wie Hormone und Stoffwechsel oder Muskeln, Knochen und Gelenke sind vertreten. Im Hinblick auf psychotherapeutische DiGAs gebe es erste Hinweise, die darauf schließen lassen, dass unbegleitetes Nutzen solcher Apps auch gefährlich werden kann; etwa bei einer Suizidgefährdung, so Bodendieck. Sie zu erkennen, erfordere viel Erfahrung und sei selbst für Ärztinnen und Ärzte häufig nicht ganz einfach.
Weitere Beiträge der VOR:DENKER (WIP)
Technik weiter ausbauen
Dennoch steht für den Mediziner Bodendieck außer Frage, dass Digitalisierung die Gesundheitsversorgung und den Arztberuf völlig verändern wird. Darin sieht er vor allem eine Chance. „Ärztinnen und Ärzte sollen nicht nur in einzelnen Leuchttürmen Entwickler solcher Anwendungen sein, sondern vorangehen und dafür sorgen, dass die neuen Möglichkeiten intelligent unter Schutz des Patienten und seiner Daten und zur Verbesserung der Versorgung genutzt werden“, sagt Bodendieck. Dafür müsse aber auch technisch noch einiges passieren: Angefangen bei der Bereitstellung von Schnittstellen, damit beispielsweise Messdaten von intelligenten Sensoren direkt ins Praxisverwaltungssystem ausgespielt werden können. Gelingt es, Daten digital zu synchronisieren und zu koordinieren, lässt sich der Krankheitsverlauf eines Menschen von Prävention über Diagnostik, Therapie bis hin zur Pflege besser steuern und nachverfolgen.
Zudem fehlen derzeit einheitliche Standards für die Datensicherheit, an denen Anbieter von digitalen Produkten sich orientieren können. „Eine Harmonisierung der digitalen Tech-Landschaft wäre wünschenswert, um möglichst viele Praxen abholen zu können“, sagt Nikolay Kolev, Geschäftsführer von Doctolib Deutschland und ehemaliger Deloitte-Partner. Zwar gebe es in Deutschland erste Bestrebungen des Gesetzgebers für zum Beispiel eine einheitliche Sicherheitszertifizierung, aber bislang keine verpflichtenden Mindestanforderungen – sehr zum Leidwesen der Praxen und ihrer Kunden.
Doctolib ist vor zehn Jahren angetreten, digital Arzttermine zu vermitteln. Gegründet in Frankreich, ist die Plattform inzwischen in mehreren europäischen Ländern verfügbar. Allein in Deutschland arbeiten nach eigenen Angaben über 200.000 Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheitsfachkräfte mit dem Gesundheitsdienstleister zusammen, der inzwischen auch Software für Patientenmanagement und Videosprechstunden sowie eine digitale Ablage für medizinische Befunde anbietet. Deutschlandchef Kolev sieht aber deutliche Unterschiede bei der Digitalisierung zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern. „In Frankreich ist der politische Wille stärker und die Kollaboration mit den Tech-Playern enger und synchroner“, sagt er. Man spüre dort den Willen, Technologieführerschaft in Europa aus Europa heraus zu besetzen.
»Eine effizientere Abbildung von Angebot und Nachfrage in den Praxen versorgt Patienten schneller mit Terminen und füllt freie Kapazitäten.«
Alice Martin Ärztin und eine der Gründerinnen von Dermanostic
Fokus auf Effizienz, statt nur zu vereinfachen
Dabei sieht der Geschäftsführer die Aufgabe von digitalen Anwendungen nicht in der bloßen Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben. Während der Corona-Pandemie hätten Schätzungen zufolge 45 Millionen Menschen in Deutschland Vorsorgetermine verpasst. „Das können wir gar nicht schnell genug aufholen. Viele Praxen sind überlastet und haben wenig Kapazitäten,“ sagt Kolev. Durch eine effizientere Abbildung von Angebot und Nachfrage in den Praxen – über etwa die digitale Plattform –, könnten Patienten deutlich schneller mit Terminen versorgt und freie Kapazitäten gefüllt werden. „Das ist eine andere Realität, die wir hier zeichnen können“, sagt Kolev.
Diese Vorteile wissen auch viele Ärztinnen und Ärzte – sowohl in Krankenhäusern als auch in Praxen – zu schätzen. „Digitale Anwendungen haben ein unglaubliches Potenzial, aber sie müssen auch richtig eingesetzt werden“, sagt Christiane Groß, Präsidentin des Ärztinnenbunds, sowie Co-Vorsitzende des Ärztlichen Beirats Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen. Gerade der Einsatz von Videosprechstunden, aber auch von Telekonsilen, also dem Heranziehen von Fachleuten über Distanz, seien wunderbare Beispiele für Vorteile der Digitalisierung, auch mit Blick auf mangelnde Arztpraxen in ländlichen Gegenden. Groß ist aber auch wichtig, dass bei medizinischen Anwendungen alle Patienten berücksichtigt werden, egal welches Geschlecht, Alter oder Herkunft diese haben. „Das Thema geschlechtsspezifische Medizin ist endlich in der Gesellschaft angekommen. Digitalisierung darf jetzt nicht die gleichen Fehler der Ungleichbehandlung wiederholen, nur weil die Algorithmen genderspezifische Belange nicht beachten“, so die Präsidentin des Ärztinnenbundes.
Je mehr digitale Medizin-Anwendungen auf den Markt kommen, desto wichtiger wird die einheitliche, klare und einfache Regulierung. Der Gesundheitsversorgung steht in den kommenden Jahren wohl weiter ein steter Wandel bevor.
Über die Digitalen Gesundheitshelfer (DiGAs)
Es gibt zahlreiche digitale Gesundheitsanwendungen, wobei nur wenige vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überprüft und ins DiGA-Register aufgenommen wurden.
- DiGAs-Apps, die dazu bestimmt sind, Erkrankungen zu erkennen und zu lindern, sie können auch bei der Diagnosestellung helfen.
- Die Anwendungen können entweder von Patienten allein oder gemeinsam mit dem Arzt benutzt werden.
- Einige DiGAs lassen sich mit digitalen Messgeräten wie Pulsmessern, Insulinmessgeräten oder auch Smart Watches verbinden – oder auch mit anderen DiGAs.
- DiGAs können vom Arzt, aber auch von den Krankenkassen verordnet werden und sind dann für den Nutzer kostenfrei.