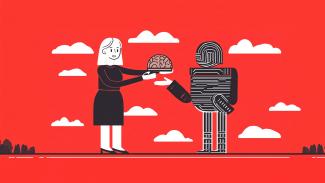Die Künstliche-Intelligenz-Forschung kann sich über einen Mangel an Aufmerksamkeit und Fördergeldern nicht beschweren. Paradoxerweise legt man dabei die Zukunft in die Hand einer Technik, die – so warnen selbst Experten – ihren Erfinder entbehrlich machen könnte. Da trägt es nicht zur Beruhigung bei, dass sich die KI-Forschung selbst ein Rätsel ist. Googles KI-Forscher Ali Rahimi provozierte im vergangenen Dezember mit der These, KI sei nichts anders als moderne Alchemie (Science Magazin, 5/2018). Man drehe so lange an den Parametern, bis der Algorithmus das gewünschte Ergebnis hervorbringe. Kürzlich legte Rahimi auf einer Konferenz in Vancouver noch einmal nach und bezeichnete die ganze KI-Forschung als Alien-Technologie.
Die Branche wisse nicht, warum sie den einen Algorithmus dem anderen vorziehe. Sie tue es einfach und schaue, wie weit sie damit komme.
Das ist nicht einmal eine provokante Behauptung. Tatsächlich können Algorithmen mit ganz unterschiedlichen Methoden zum gleichen Ergebnis kommen. Meistens zeigt erst das Resultat, welches der bessere Lösungsweg ist. Wissenschaftlich ist das natürlich unbefriedigend. Inzwischen gibt es Prüfmethoden, die selbstlernende Software daraufhin untersuchen, wie sie zu ihren Resultaten gelangt, das heißt konkret: welchen Einfluss eine bestimmte Variable auf sie nimmt. Das Verfahren, das 2015 an der TU Berlin und dem Fraunhofer Institut für selbstlernende Systeme entwickelt wurde, ist aber noch wenig bekannt und kommt in der Praxis bisher nicht zur Anwendung, sagt Wojciech Samek, Forschungsgruppenleiter am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut. Und auch diese Methode muss bis auf weiteres ohne eine Metatheorie auskommen.